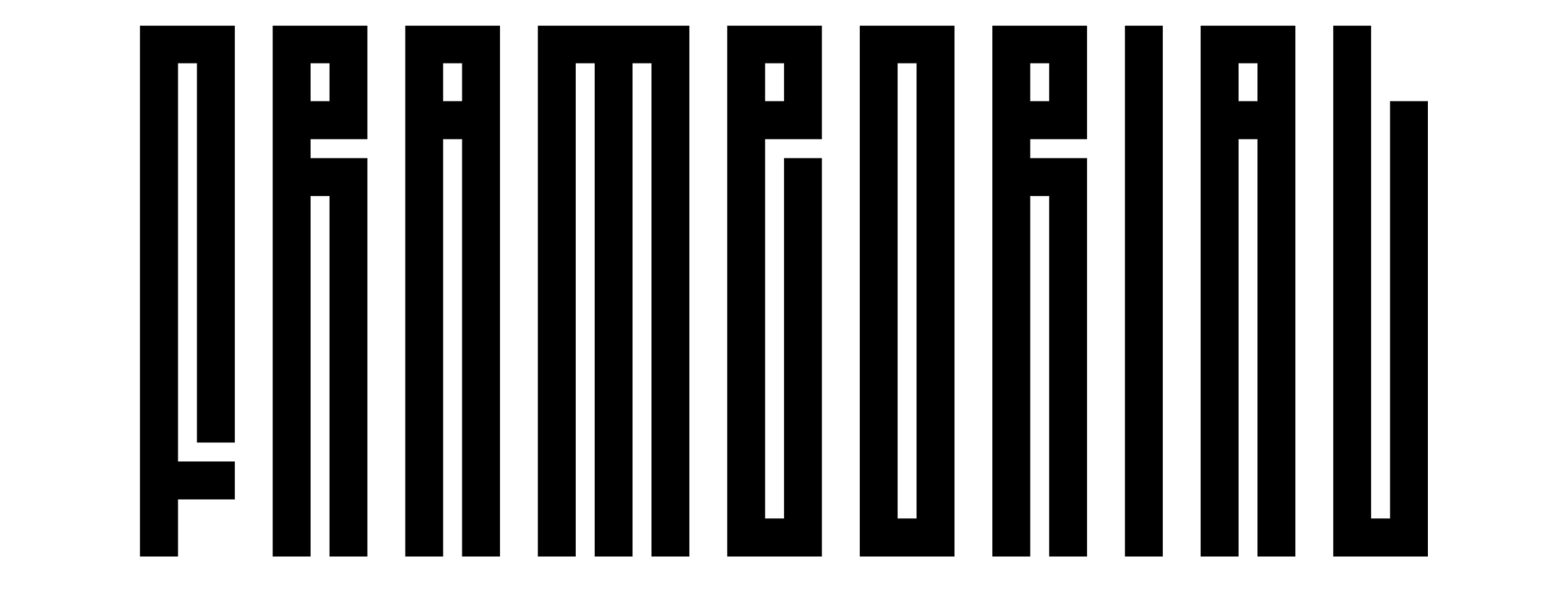NS-Kontinuitäten im Düsseldorfer Stadtbild
Zum vergangenen Rundgang in der Kunstakademie Düsseldorf präsentierte die Klasse von Maximilane Baumgartner unter Memory Acts for a Learning Space die künstlerischen Ergebnisse ihrer Recherchen über Künstlerinnen und Künstler der NS-Zeit, die auch in der Bundesrepublik sehr erfolgreich waren. Wie konnte das sein?
von Jennifer Braun
Der Winterrundgang an Kunstakademien ist oftmals die erste Ausstellung als Kunststudent*in. Die Arbeiten des vergangenen Semesters werden in Klassen geordnet einer breiten Öffentlichkeit präsentiert, jede*r zeigt, was er/sie kann. Die Klasse der Vertretungsprofessorin Maximiliane Baumgartner entschied sich dieses Jahr gegen Alleingang und für ein gemeinsames Projekt – eines mit musealem Anspruch.
Die Ausstellung beschäftigte sich mit Künstler*innen des Nationalsozialismus, die auch in der jungen Bundesrepublik öffentliche Orte in Düsseldorf prägten. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Brauneis entstanden, der im Jahr 2022 die Ausstellung Die Liste der ‚Gottbegnadeten‘. Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik“ im Deutschen Historischen Museum in Berlin kuratiert hatte.
Die „Gottbegnadeten-Liste“
1944 gab Joseph Goebbels eine Liste mit 1041 Namen in Auftrag. Diese 39-Seiten lange „Gottbegnadeten-Liste“ enthielt die Namen jener kultureller Akteure, die das Regime für „unabkömmlich“ („uk“) erklärte. Diese waren in die Kategorien „Schriftentum“ (Literatur), bildende Kunst, Musik, Theater, Film und Rundfunk unterteilt. Die Kernliste exklusive der „Sonderliste“ und „Alle übrigen“ enthielt nur Männer. Die „Gottbegnaten-Liste“ diente nicht der öffentlichen Anerkennung, auch wenn der heroisch anmutende Titel das suggeriert, denn sie wurde nicht publiziert. Die Intention hinter der Liste war pragmatisch: Wer auf der Liste stand, war vom Kriegsdient befreit, sollte sich aber weiterhin in den Dienst der Kulturpropaganda stellen.

aus den Sparten Literatur, Bildende Kunst, Musik und Theater enthält, darunter
114 Maler und Bildhauer, Berlin, Bundesarchiv: R 55/20252a, Bl. 1f.
Die Künstler der „Gottbegnadeten-Liste“ nach dem Krieg
Man würde meinen, dass sich diese zur NS-Zeit erfolgreichen Künstler*innen nach dem Fall des Regimes zurückgezogen hätten. Bestimmt hätten sie weitergearbeitet, aber nur im kleinen Rahmen. Vielleicht einige Porträts für Verbündete und Täter*innen von früher. Heimlich. Aber sie wären bestimmt aus dem öffentlichen Ansehen verschwunden, geächtet und ausgestoßen als Mitläufer*innen und Mitgestalter*innen des Regimes. Im Gegenteil: Es ging alles weiter wie bisher. Sie erhielten große Aufträge: Schulen, Theater, Krankenhäuser, Rathäuser und öffentliche Plätze. Sogar Mahnmale gestalteten sie. Einen Bruch mit der Vergangenheit gab es nicht:
„Zwar nahmen sie im formalen Sinne regelmäßig insofern Anpassungen an den Zeitgeist der Nachkriegsjahre vor, als ihre Arbeiten weniger monumental und heroisch ausgeführt wurden. Gleichzeitig sah jedoch keiner der betreffenden Künstler die Notwendigkeit, sich in dem Zuge von der Karriere, den Ehrungen oder dem Kunstbegriff im Nationalsozialismus zu distanzieren, sie konnten im Gegenteil bei Wettbewerben oder der Vergabe für Kunst-am-Bau-Aufträgen in der Bundesrepublik und Österreich auf bestehende Seilschaften, wie zum Beispiel den Kontakten zu hochrangigen Architekten des „Dritten Reichs“, zurückgreifen. Die Rezeption ihrer Werke bot häufig Anlass zur Artikulation einer konservativen, auch in den Nachkriegsjahrzehnten ungebrochen antimodernen Kunstauffassung.“ Wolfgang Brauneis

Eine Intervention gegen das Vergessen
Der Ausgangspunkt der Ausstellung war ein Stadtspaziergang der Klasse Baumgartner mit Wolfgang Brauneis. Zusammen besuchten sie Orte in Düsseldorf, die nach 45 von NS-konformen Künstler*innen gestaltet wurden. Im Nachgang visualisierten die 23 Studierenden den Rundgang künstlerisch: Eine kritisch kommentierte Karte der insgesamt 18 Stationen, dazu künstlerische Antworten auf diese waren das Ergebnis der Recherchen.
Irma Goecke (1895-1976) war laut eigenen Angaben die erste eingeschriebene Frau an der Kunstakademie Düsseldorf im Jahr 1917. Zwischen 1940 und 1960 Professorin für Bildwirkerei und -stickerei an der Akademie der Künste in Nürnberg. 1941 trat sie in die NSDAP ein, während des Zweiten Weltkriegs produzierte sie Tapisserien für das Reichsparteitagsgelände und für SS-Unterkünfte. Trotz allem wurde sie 1962 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Gabriela Tudors Arbeit Hinterfragen der Gobelinfäden beschäftigt sich kritisch mit der Biografie: Fäden umspannen das Bild einer nächtlichen Ansicht im monumentalen Treppenhaus der Kunstakademie. Das Bild wird so undurchsichtig verstrickt wie Irma Goecke selbst.
Georg Kolbes (1877-1947) Name ist heute insbesondere durch das nach ihm benannte Museum in Berlin bekannt – weniger durch seine Nennung auf der „Gottbegnadeten-Liste“. Juliana Paek thematisierte seine Sulptur Der aufstrebende Jüngling (1931-33/1949). 1931 gewann Kolbe den Wettbewerb für die Realisierung des Heinrich-Heine Denkmals, welches aus antisemitischen Gründen dann aber abgelehnt wurde. Schließlich brachte Kolbe das Denkmal 1949 zur Beendigung in der Nähe des heutigen NRW-Forums. Paeks (Der aufstrebende Jüngling) Diagrammatic Thoughts Consisting of Several Associations Dealing with Georg Kolbe – A Shapeshifter Through Four Historic Periods/Reflections of a Dehumanized Person visualisiert die Geschichte des Denkmals als Stammbaum und bezieht sich so auf die nationalsozialistische Obsession mit Blutlinien und Rassentheorien.
Die unter Denkmalschutz stehende Golzheimer Siedlung im Düsseldorfer Nordpark mag heute den wenigsten bekannt sein, dabei war sie ein nationalsozialistisches Wohnraumprojekt von 1937. Der Bildhauer der „Gottbegnadeten-Liste“ Hans Breker (1906-1993) hatte dort sein Atelierhaus, welches heute Teil einer Künstler*innensiedlung ist. Das Video Zweite schwindende Chance von Lucien Liebecke, Aylin Ismihan Kabakcı, Ziran Pei und Paula Slomke beschäftigt sich mit Hans Brekers Plastik Die Meerschnecke (1987) und zeigt auch Ansichten der Golzheimer Siedlung: Weiße Einfamilienhäuser, leere Straßen, Die Zahl 1937 als eine der Hausnummern. Die eisernen Eingangstore einiger Häuser wurden nach dem Krieg angepasst: Eiserne Blumen wurden auf die eingearbeiteten Hakenkreuze draufgeschweißt.
Die Klasse erhielt für ihre Rundgangspräsentation den Förderpreis der Gesellschaft der Freunde und Förderer in Höhe von 1.500 Euro.




Memory Acts for a Learning Space
Raum 217
5. – 9. Februar 2025, 10 – 20 Uhr
Klasse Maximiliane Baumgartner
in Kollaboration mit Wolfgang Brauneis
Rundgang Kunstakademie Düsseldorf,
Eiskellerstraße 1
Quellen
1) Gottbegnadeten-Liste (unvollständig), Deutsche Digitale Bibliothek [abgerufen 14.05.2025]
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/G5KUMOQP3MY7DE7UTF2ZWCGRBKC3GCLE?lang=de
2) Wolfgang Brauneis: Die „Gottbegnadeten-Liste“, LEMO – Lebendiges Museum Online, 31. Mai 2022 © Deutsches Historisches Museum, Berlin [abgerufen 14.05.2025]
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kunst-und-kultur/die-gottbegnadeten-liste